Der 1947 erschienene Roman „La Peste“ des französischen Philosophen und Literatur-Nobelpreisträgers Albert Camus erlebt aus naheliegenden Gründen zurzeit eine Renaissance. Karin Neubarth-Raub und Michael Raub haben ihn auch wieder gelesen, Karin als Romanistin natürlich auf Französisch, Michael lieber auf Deutsch.
Über den pre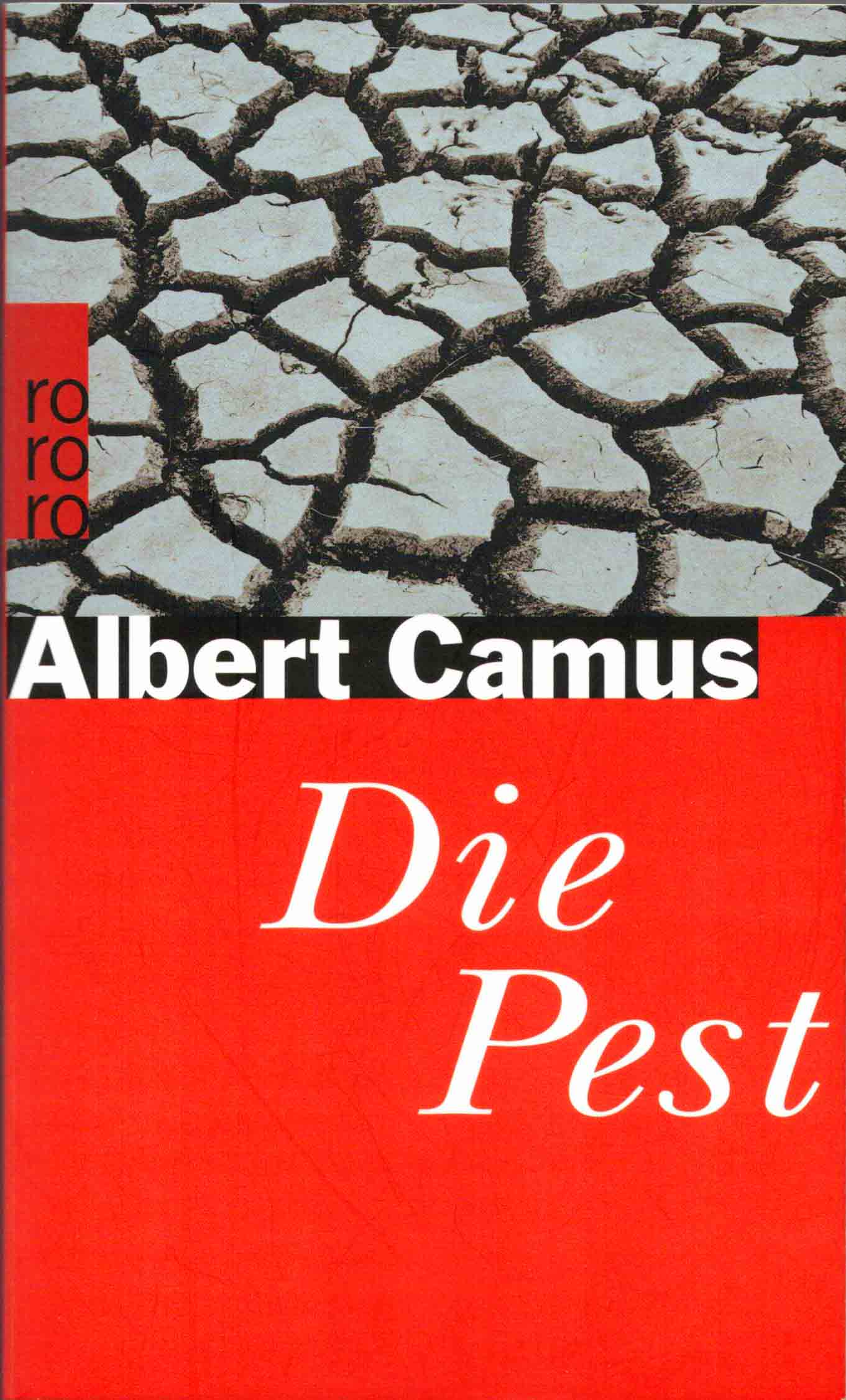 isgekrönten Roman ist viel geschrieben worden, es gibt verschiedene Interpretationsansätze. Wenn wir uns heute dem Pest-Roman noch einmal nähern und ihn zur Lektüre empfehlen, dann unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Covid 19-Pandemie, die in Deutschland wie in Frankreich fast alle Bereiche des privaten, öffentlichen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Lebens beherrscht. Wir möchten ein paar Denkanstöße dazu geben, die heutige Situation in Deutschland und Frankreich mit Camus‘ Buch zu vergleichen.
isgekrönten Roman ist viel geschrieben worden, es gibt verschiedene Interpretationsansätze. Wenn wir uns heute dem Pest-Roman noch einmal nähern und ihn zur Lektüre empfehlen, dann unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Covid 19-Pandemie, die in Deutschland wie in Frankreich fast alle Bereiche des privaten, öffentlichen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Lebens beherrscht. Wir möchten ein paar Denkanstöße dazu geben, die heutige Situation in Deutschland und Frankreich mit Camus‘ Buch zu vergleichen.
Der Plot des Werkes ist eher unspektakulär: In der heute algerischen, in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts aber französischen Küstenstadt Oran – sie erscheint in dem Roman als rein französische Stadt, in der keine Araber vorkommen – werden im Frühling erst vereinzelt, dann immer häufiger verendende und tote Ratten gefunden, was man aber nicht besonders ernst nimmt, auch nicht, als die ersten Menschen mit typischen Pestsymptomen sterben. Der Protagonist und Erzähler, der Arzt Docteur Rieux, begreift schnell, was wirklich in Oran geschieht, aber es dauert lange, bis die Behörden die Seuche nicht mehr leugnen und dann über die Stadt eine jähe Quarantäne verhängen, die alle innerhalb der Stadt Lebenden von denen außerhalb trennt. Die Pest breitet sich in Oran allmählich aus, der Focus der Erzählung liegt aber darauf, wie Rieux und eine Handvoll seiner Bekannten auf die neue Lebenssituation auf unterschiedliche Weise reagieren und miteinander agieren. Erst im Sommer gerät die Pest, nun auf ihrem Höhepunkt mit all ihren Schrecknissen drastisch-distanziert zugleich geschildert, in den direkten Blick. Anschließend fällt die Handlung ab, die Figuren und ihr Innenleben rücken wieder mehr in den Mittelpunkt, und schließlich ebbt die Seuche ab. Nach deren Verschwinden wird die Quarantäne aufgehoben, die Bewohner feiern das Wiedersehen mit den von ihnen zuvor Getrennten und ihr Überleben. Für Rieux bleibt jedoch Gewissheit, dass die Pest niemals ganz verschwindet und jederzeit wieder zurückkehren kann. „…car il savait ce que cette foule en joie ignorait, (..) que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais (…) TB folio S. 279.
Vergleicht man das Pest-Szenarium des Buches mit der gegenwärtigen Corona-Situation in unseren beiden Nachbarländern, springt als erstes ins Auge, dass „Quarantäne“ in beiden Fällen etwas ganz anderes bedeutet: Die Stadt Oran wird vollständig von und nach außen abgeschottet, als Folge sind Menschen auf einmal getrennt, wenn diese zufällig innerhalb oder außerhalb der Stadt waren. Hier scheint es sich um eine auf Oran beschränkte Epidemie zu handeln, während die heutige Pandemie sich über die ganze Erde verbreitet, mit Auswirkungen, die noch nicht abzusehen sind. In Oran selbst, so liest man als Zeitzeuge der Corona-Epedemie erstaunt, scheint es keinerlei Vorsichtsmaßnahmen gegen Infektionen zu geben, die Menschen bewegen sich unbefangen und frei, treffen sich in Cafés, Restaurants und Kinos. (Erst ab dem Sommer wird in Oran in einem Sportstadion ein Quarantänelager eingerichtet, in dem die Betroffenen eng zusammenleben, jedoch nicht vor Infektionen untereinander geschützt sind.) Vom heute bei uns überall peinlich beachteten social distancing und Stay home! keine Spur. Während aber die Deutschen bei allem Lockdown noch relativ viele Freiheiten genießen, die nun ab Mitte Mai sogar erweitert werden, hat Frankreich mit seinen vielen schweren Erkrankungen und Toten vor alle m im Grand Est rigidere Maßnahmen ergriffen, was sich an der bis zum 11. Mai geltenden fast vollständigen Ausgangssperre zeigt. Die psychische Belastung vieler Menschen heutzutage, vor allem bei beengten Wohnverhältnissen und familiären Konflikten, dürfte größer sein als in der Romanhandlung, selbst wenn man berücksichtigt, dass wir über die digitalen Medien problemlos weltweit kommunizieren können.
m im Grand Est rigidere Maßnahmen ergriffen, was sich an der bis zum 11. Mai geltenden fast vollständigen Ausgangssperre zeigt. Die psychische Belastung vieler Menschen heutzutage, vor allem bei beengten Wohnverhältnissen und familiären Konflikten, dürfte größer sein als in der Romanhandlung, selbst wenn man berücksichtigt, dass wir über die digitalen Medien problemlos weltweit kommunizieren können.
Der für Camus wichtige Aspekt der unfreiwilligen Trennung von Menschen, die sich lieben, lässt sich in beiden Ländern nachvollziehen: Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Kontaktverbot für Freunde und Verwandte, Grenzschließungen werden Spuren hinterlassen.
Das heute oft betonte, bis an die Grenzen des Menschenmöglichen gehende Engagement von Pflegern, Ärzten und allen anderen findet seine Entsprechung im Roman: Rieux und seine Freunde setzen sich teils beruflich, teils auch privat mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften für die Bekämpfung der Seuche ein. Die heutigen Leser dürften allerdings froh sein, die Pandemie in der Gegenwart zu erleben, denn in Oran beschränkt sich die medizinische Versorgung auf ärztliche Hausbesuche oder die Einlieferung in neu eingerichtete Behelfskrankenhäuser, wo eine Therapie allenfalls in Ansätzen stattfindet, so dass die nicht zu vermeidenden Toten zuerst in Massengräber geworfen, schließlich in Krematorien verbrannt werden, was an die schlimmen Bilder von überforderten Bestattungsunternehmen in einigen Ländern erinnert. Es gibt weder eine ausreichende Versorgung mit Medikamenten noch Intensivstationen, die glücklicherweise heutzutage sogar länderübergreifend funktionieren: So durften z.B. in der Villingen-Schwenninger Klinik auch französische Patienten geheilt entlassen werden; die medizinische Forschung erfolgt international vernetzt.
Von der Politik und in den Medien beider Länder wird betont, wie wichtig der Einsatz der vielen oft unbekannten „Helden“ für die Bewältigung der medizinischen und anderer Probleme sei, die für das Funktionieren der Gesellschaft unabdingbar sind. Rieux, der einfache Hausarzt, und seine Freunde sind solche unscheinbaren „Helden“, wollen aber keine sein. Sie sehen es einfach als ihre Pflicht an, nach ihren jeweiligen Möglichkeiten und Kräften gegen die Pest zu kämpfen und zu helfen, wo sie könn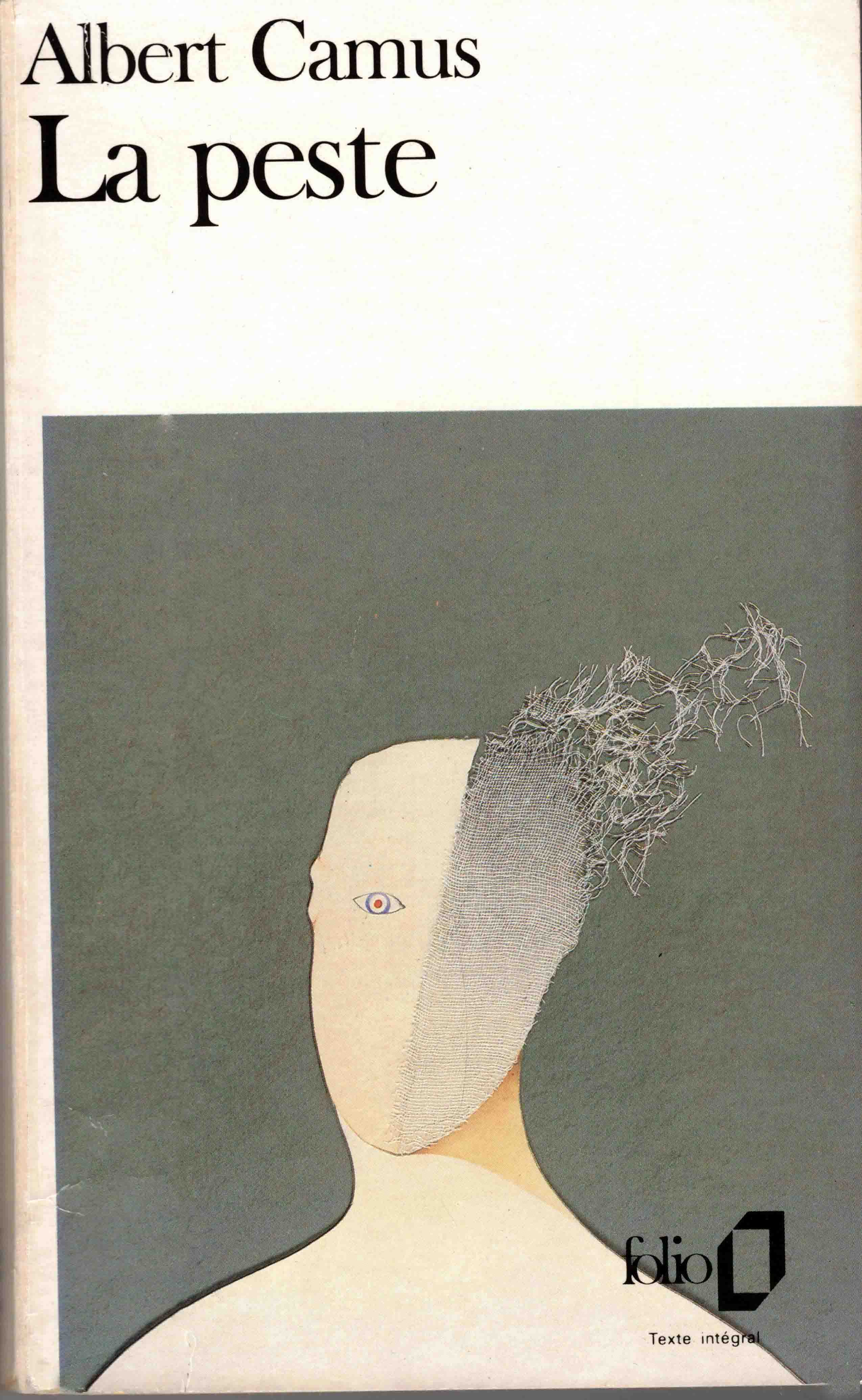 en. Sie wollen nicht heilig, sondern bloß einfach „anständig“ sein. „Je n’ai pas de goût, je crois, pour l’héroïsme et la sainteté. Ce qui m’intéresse, c’est d’être un homme.“ (a.a.O., S. 230). Noch weniger sind sie die „Helden“ mancher Theaterstücke, Romane oder Katastrophenfilme, denen es dann in letzter Minute gelingt, möglichst die ganze Welt zu retten, wofür sie dann gewöhnlich noch mit einem Liebes-Happy-End belohnt werden. Der Roman hütet sich vor solchem Kitsch – im Gegenteil: Rieux, der durch die Quarantäne von seiner Frau getrennt worden ist, erhält gegen Schluss des Romans ein Telegramm mit der Nachricht von ihrem Tod, und sein bester Freund kommt noch an der Pest um, als diese schon besiegt zu sein scheint.
en. Sie wollen nicht heilig, sondern bloß einfach „anständig“ sein. „Je n’ai pas de goût, je crois, pour l’héroïsme et la sainteté. Ce qui m’intéresse, c’est d’être un homme.“ (a.a.O., S. 230). Noch weniger sind sie die „Helden“ mancher Theaterstücke, Romane oder Katastrophenfilme, denen es dann in letzter Minute gelingt, möglichst die ganze Welt zu retten, wofür sie dann gewöhnlich noch mit einem Liebes-Happy-End belohnt werden. Der Roman hütet sich vor solchem Kitsch – im Gegenteil: Rieux, der durch die Quarantäne von seiner Frau getrennt worden ist, erhält gegen Schluss des Romans ein Telegramm mit der Nachricht von ihrem Tod, und sein bester Freund kommt noch an der Pest um, als diese schon besiegt zu sein scheint.
Welche Haltung kann der Mensch angesichts des Bösen einnehmen? Diese Frage stellte sich während des zweiten Weltkriegs und der Besetzung Frankreichs durch das nationalsozialistische Deutschland. Camus arbeitete in Paris als Journalist für die Résistance, getrennt von seiner Frau, die bis zur Befreiung in Algerien blieb.
Ob Epidemien, Anfälligkeit für totalitäre Ideologie, inhumanes Denken und Handeln, stets ist der Mensch gefordert, beharrlich und mit Sympathie für die Mitmenschen gegen das Böse zu arbeiten.
Auch wenn dies niemals für alle Zeiten gelingen kann.
Karin Neubarth-Raub und Michael Raub
Bild Albert Camus: Von Studio Harcourt – RMN, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76812482
